Die Hebel der Zukunft
- Stefan Tewes

- 12. Aug. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Theoretische Grundlagen organisationaler Zukunftsgestaltung
Zukunft lässt sich in einer zunehmend dynamischen und komplexen Welt nicht länger als linear planbares Ziel begreifen. Sie ist vielmehr ein emergenter Gestaltungsraum, in dem Organisationen fortlaufend zwischen Stabilität und Wandel, zwischen Erneuerung und Ausschöpfung balancieren. Klassische Strategiemodelle geraten in diesem Umfeld nicht nur an ihre Grenzen, sondern sind zunehmend wirkungslos, um in einer Geschäftswelt mit permanenter Veränderung Wert zu erzeugen.
Wer sich erfolgreich in Richtung Zukunft bewegen will, braucht ein klares Verständnis für die zentralen Stellschrauben strategischer Gestaltung. Drei miteinander verbundene Zukunftshebel wirken hierbei als strategische Achsen. Jeder dieser Hebel setzt spezifische organisationale Kontexte in Beziehung und beantwortet damit eine grundlegende Führungsfrage: Der Richtungshebel verknüpft interne Antriebe – wie Vision, Purpose und Kultur – mit externen Impulsen und Trends und richtet den Blick auf die Frage „Wohin?“. Der Potenzialhebel verbindet Kunden, Stakeholder und die Organisation selbst und konzentriert sich auf die Frage „Womit?“, also auf die Ressourcen, Kompetenzen und Netzwerke, mit denen Zukunft gestaltet werden kann. Der Werthebel schließlich schlägt die Brücke zwischen Angebot und Entwicklung und fragt „Wozu?“ – nach dem Beitrag, den eine Organisation für Markt, Gesellschaft und Umwelt leisten will.
Der Richtungshebel zielt darauf, die normative Ausrichtung einer Organisation mit ihrer Umweltwahrnehmung zu verschränken. Theoretisch basiert er auf der Verbindung von Inside-out- und Outside-in-Ansätzen mit systemtheoretischen Konzepten wie struktureller Kopplung und Sensemaking. Orientierung entsteht nicht allein durch Anpassung an externe Anforderungen, sondern durch die bewusste Selbstpositionierung im Lichte relevanter Umweltirritationen. So kann etwa ein globaler Baustoffhersteller, dessen Vision darin besteht, nachhaltiges Bauen weltweit zugänglich zu machen, durch eine holistische Trendanalyse regulatorische Verschärfungen in der Klimapolitik und wachsende Nachfrage nach CO₂-armen Baustoffen identifizieren. Indem das Unternehmen diese externen Entwicklungen mit seiner Vision verknüpft, richtet es Investitionen gezielt auf klimapositive Produktlinien und kooperative Forschungsprojekte aus.
Der Potenzialhebel hingegen fokussiert auf die operative Handlungsfähigkeit. Er vereint drei Kontexte: die Kunden mit ihren Bedürfnissen und Loyalitätsmustern, die Partner als Teil von Kollaborationen, Ökosystemen oder Coopetition-Formaten, und die Organisation mit ihren Strukturen, Prozessen, Kompetenzen, Systemen und Ressourcen. Seine theoretische Grundlage bilden die Dynamic-Capabilities-Perspektive, Netzwerktheorien und adaptive Organisationsdesigns. Potenziale entstehen nicht durch den bloßen Besitz von Ressourcen, sondern durch deren orchestrierte Nutzung in flexiblen, vernetzten Strukturen. Ein mittelständisches Medizintechnikunternehmen, das steigende Nachfrage nach Telemedizinlösungen erkennt, kann dies beispielhaft umsetzen: Durch eine gezielte Partnerschaft mit einem IT-Start-up erlangt es digitale Plattformkompetenzen, während intern ein interdisziplinäres Projektteam mit agilen Methoden die Entwicklung von Prototypen bis zur Markteinführung steuert. In dieser Konstellation entfaltet der Potenzialhebel seine Wirkung, indem er Kundenkenntnis, Partnernetzwerke und organisationale Flexibilität zu einem beschleunigten Innovations- und Marktzugang bündelt.
Der Werthebel schließlich richtet den Blick auf den Beitrag und die Wirkung der Organisation. Er verbindet die Angebotsdimension – Produkte, Dienstleistungen, Informationen, Plattformen – mit der Entwicklungsdimension, die Kanäle, Feedback, Interdependenz und Lernen umfasst. Seine theoretische Basis findet er in der Service-Dominant Logic sowie in den Konzepten des Corporate Learnings, die Wertschöpfung als ko-kreativen, adaptiven Prozess zwischen Anbieter, Kunden und weiteren Akteuren begreifen. Ein SaaS-Unternehmen kann diesen Hebel nutzen, indem es eine neue Analyseplattform einführt und parallel ein strukturiertes Feedback-Loop-Design etabliert. Nutzungsmuster werden systematisch ausgewertet, Hypothesen überprüft und Funktionen iterativ angepasst. Gleichzeitig wird der gesellschaftliche Nutzen – etwa durch CO₂-Einsparungen in Lieferketten – transparent gemacht. So greifen Produktleistung, Nutzererlebnis und gesellschaftlicher Beitrag systematisch ineinander.
Fazit
Die drei Zukunftshebel sind weit mehr als separate Werkzeuge. Ihre volle Wirksamkeit entfalten sie erst in ihrem Zusammenspiel – als integratives Steuerungssystem, das Orientierung, Handlungsfähigkeit und Wertbeitrag in einen kohärenten Rahmen bringt. Der Richtungshebel definiert die organisationale Ausrichtung, der Potenzialhebel mobilisiert die dafür nötigen Ressourcen und Netzwerke, und der Werthebel stellt sicher, dass das Ergebnis nicht nur marktfähig, sondern auch relevant ist.
In der systemischen Perspektive greifen diese Hebel wie ineinander verzahnte Achsen: Jede Bewegung an einem Hebel wirkt sich auf die anderen aus und verändert so das gesamte strategische Gefüge der Organisation. An den Schnittpunkten dieser Achsen entstehen die Sweetspots – jene dynamischen Konstellationen, in denen externe Chancen und interne Kompetenzen produktiv aufeinander treffen. Wer diese Interdependenz versteht und gezielt gestaltet, kann Zukunft nicht nur antizipieren, sondern aktiv hervorbringen. Damit wird klar: Zukunftsgestaltung ist kein lineares Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess des Ausrichtens, Aktivierens und Wertschaffens – gesteuert über ein vernetztes System von Hebeln, das Stabilität und Wandel in produktive Balance bringt.
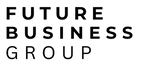



Kommentare