Systemische Emergenz
- Stefan Tewes

- 7. Okt. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Warum strategischer Fit nicht mehr reicht – und Zukunft in Sweetspots entsteht
Die klassische BWL beruhte auf einer klaren Idee: Wer seine internen Fähigkeiten mit den externen Anforderungen in Einklang bringt, erreicht strategischen Fit – und damit eine stabile Position im Markt. SWOT, Branchenlogik, Wettbewerbsstrategien, Resource-Based View: all diese Werkzeuge dienten dem einen Ziel, Innen und Außen möglichst deckungsgleich zu machen. Das funktionierte in Umwelten, die wir rückblickend als vergleichsweise stabil erleben. Heute jedoch zeigt sich: Was passt, passt oft nur noch für einen Moment. Der einmalige Abgleich von innen und außen ist zum Risiko geworden – nicht, weil er falsch wäre, sondern weil er zu statisch denkt in einer Realität, die zyklisch und beschleunigt ist.
Dynamik statt Stabilität
Die Gegenwart ist geprägt von Gleichzeitigkeit: technologische Beschleunigung, Werte-Verschiebungen, ökologische Grenzen. Strategien, die gestern Orientierung gaben, wirken heute wie Momentaufnahmen. Vier Entwicklungen markieren den Bruch:
Geschwindigkeit: Innovations- und Akzeptanzzyklen verkürzen sich dramatisch; Prognosen verlieren schnell ihre Halbwertszeit.
Komplexität: Veränderungen sind rückgekoppelt – Politik, Wirtschaft, Legitimation, Gemeinschaft verschränken sich und wirken quer durch Wertschöpfungsketten.
Fragilität von Ressourcen: Was einst selten und schwer imitierbar war, wird durch KI, Plattformlogiken oder globale Skalierung beschleunigt substituierbar.
Trägheit der Instrumente: Viele Tools beschreiben den Status quo (das „Foto“), nicht aber die Bewegung (das „Video“ der Veränderung).
Der Fit scheitert also nicht an Logik, sondern an der Linearität. Er sichert Stabilität, wo dynamische Anschlussfähigkeit zählt.
Sweetspots: Dynamische Gleichgewichtszonen statt statischer Zielpunkte
Sweetspots sind die Antwort auf diese Lage – nicht als neuer Fixpunkt, sondern als dynamische Gleichgewichtszonen, in denen innere Handlungsfähigkeit und äußere Möglichkeitsräume produktiv aufeinandertreffen. Sie entstehen dort, wo externe Impulse intern anschlussfähig werden und Emergenz ermöglichen: Neues, das nicht einfach geplant wurde, sondern im Zusammenspiel von Innen und Außen hervorkommt. Entscheidend ist: Sweetspots sind temporär und fragil. Sie müssen identifiziert, genutzt, losgelassen – und immer wieder neu gefunden werden. Zukunftsfähigkeit heißt deshalb nicht, den Fit zu konservieren, sondern die Fähigkeit, Sweetspots fortlaufend zu erzeugen.
Diese Perspektive verschiebt die Führungsaufgabe: Innen-Außen-Differenz ist nicht die Lücke, die man schließt, sondern die produktive Spannung, die man gestaltet. Transformation ist in diesem Verständnis kein planbarer Angleichungsprozess, sondern ein Resonanzgeschehen: Außen irritiert, innen selektiert – und aus dieser wechselseitigen Bearbeitung entsteht Neues.
Emergenz als Führungslogik: Drei Grundhaltungen
Wer Emergenz ermöglicht, führt anders. Drei Haltungen sind zentral:
Selbstbeobachtung: Die eigene „DNA“ – Vision, Purpose, Zweck, Identität, Kultur – wird nicht als Dogma, sondern als Reflexionsraum verstanden. Man überprüft fortlaufend, was davon in der aktuellen Lage trägt und wo Re-Interpretation nötig ist.
Umweltsensibilität: Trends, Kundenbedürfnisse, Partner-Ökosysteme und Regulatorik werden nicht isoliert gescannt, sondern als vernetztes Feld gelesen. Es geht um Signalerkennung statt rückblickender Exegese.
Resonanzräume: Orte, Formate und Routinen, an denen Außenimpulse mit Innenkompetenzen in Berührung kommen – Co-Creation, datenbasierte Experimente, interdisziplinäre Lernschleifen. Erst dort entsteht Emergenz.
Praktische Anschlüsse: Sweetspots identifizieren und nutzen
Wie aber lässt sich diese Logik systemischer Emergenz praktisch gestalten? Der entscheidende Punkt ist, dass Zukunftsfähigkeit kein Produkt abgeschlossener Strategien mehr ist, sondern Ergebnis eines kontinuierlichen Aushandelns zwischen Innen und Außen. Organisationen, die Sweetspots gestalten wollen, müssen diese Bewegung nicht nur aushalten, sondern bewusst ermöglichen. Vier Prinzipien helfen, diesen Prozess in Führung und Steuerung zu verankern.
Differenz produktiv zu machen bedeutet, die Innen-Außen-Spannung nicht zu glätten, sondern zu kultivieren. Innen – Strukturen, Prozesse, Kultur, Kompetenzen etc. – und Außen – Märkte, Kunden, Partner, Trends etc. – folgen unterschiedlichen Logiken. Diese Differenz ist keine Störung, sondern die eigentliche Quelle organisationaler Intelligenz. Wer sie sprachfähig macht, entdeckt die Übergangszonen, in denen Resonanz entsteht. Die Fähigkeit, mit Differenz umzugehen, wird damit zur zentralen Zukunftskompetenz: nicht im Sinne der Angleichung, sondern der produktiven Kopplung.
Beobachten in Zyklen statt Planen in Linien ist der zweite Schlüssel. Organisationen, die Veränderung als kontinuierlichen Prozess begreifen, entwickeln eine zyklische Steuerungslogik. Sie unterscheiden zwischen Phasen des Experimentierens und der Effizienz, zwischen Wachstum, Bewahrung und Erneuerung. Dieses Denken schafft rhythmische Klarheit, ohne die Bewegung zu verlieren. Es ersetzt Planungssicherheit durch Beobachtungssicherheit – das Wissen, in welcher Phase man sich befindet und was die Organisation gerade braucht. So wird Emergenz führbar, ohne sie zu verplanen.
Daten wiederum sind die Sensorik dieser Bewegung. Sie sind keine Wahrheit, sondern Rückkopplung – Hinweise darauf, wo außen etwas ruft und innen etwas antwortet. Richtig verstanden sind Daten keine Kontrolle, sondern Resonanzindikatoren: Sie zeigen, wo Muster entstehen, wo Signale verstummen oder wo neue Konstellationen sichtbar werden. Resonanz wird messbar, wenn Informationen nicht im Berichtswesen verharren, sondern in Entscheidungen zirkulieren. Wer Daten als lernende Schleifen begreift, findet Sweetspots früher – und verliert nicht den Anschluss.
Partizipation schließlich erweitert die Wahrnehmungsfähigkeit der Organisation. In komplexen Umfeldern kann niemand mehr allein sehen, hören oder verstehen, was relevant wird. Organisationen brauchen kollektive Sensoren – Mitarbeitende, Kunden, Partner, Netzwerke. Partizipation ist die soziale Architektur der Emergenz: Sie schafft Räume, in denen Signale aus unterschiedlichen Perspektiven gedeutet und in Handlung übersetzt werden können. Damit wird Resonanz zu einem geteilten, organisationellen Phänomen – nicht zu einer Führungsaufgabe, sondern zu einem gemeinsamen Prozess.
Sweetspots zeigen sich überall dort, wo dieses Wechselspiel gelingt. Patagonia etwa verbindet den inneren Antrieb – den Schutz des Planeten – mit dem äußeren Nachhaltigkeitsdruck und schafft dadurch eine außergewöhnlich stabile Resonanz zwischen Marke, Gesellschaft und Kultur. Datengetriebene Plattformen wie Spotify oder Netflix koppeln interne Algorithmenkompetenz mit externen Nutzersignalen und erzeugen so in Echtzeit immer neue Momente der Passung. Und in lernenden Organisationen, in denen Feedback institutionalisiert ist, wird Innovation zum Normalfall: Rückkopplung ersetzt Kontrolle, und Resonanz wird Teil der täglichen Arbeit.
Werkzeuge für die Praxis
Ansatz | Worum es geht | Woran man Resonanz erkennt |
Zyklisches Arbeiten | Phasenbewusst entscheiden (z. B. Experiment vs. Effizienz) | Time-to-Learn, Iterationsgeschwindigkeit, Übergänge ohne Bruch |
Daten-Loops | Hypothesen testen, A/B-Lernen, Echtzeit-Signale nutzen | stabile Signal-Entscheid-Wirkung-Ketten; abnehmende Blindflugzeiten |
Resonanzmetriken | Tiefe statt nur Reichweite messen (NPS, Engagement, Wiederkauf, „leuchtende Augen“) | zunehmende Tiefe der Interaktion, aktive Fürsprache |
Partizipative Formate | Co-Creation mit Kunden, Partnern, Mitarbeitenden | Qualität der Beiträge, Übernahme in Entscheidungen, Buy-in |
Narrative Kohärenz | Werte als Kompass, der Vielfalt bündelt | konsistente Entscheidungen trotz Tempo; geringe „strategische Reibung“ |
Fazit
Der strategische Fit war das Denkmodell einer Welt, die Stabilität versprach. Die Gegenwart fordert etwas anderes: Zukunft als fortdauernde Gestaltungsaufgabe. Sweetspots sind keine fixen Zielpunkte, sondern flüchtige Zonen produktiver Passung, die im Wechselspiel von innen und außen immer wieder neu entstehen. Führung heißt heute, diese Emergenz nicht zu verhindern, sondern zu ermöglichen – mit Zyklusbewusstsein, Daten-Loops, partizipativen Sensoren und einer Sprache, die Differenz nicht verdeckt, sondern in Gestaltung überführt. So wird Zukunftsfähigkeit nicht versprochen, sondern praktiziert: nicht als Projekt oder Event, sondern als permanenter Modus.
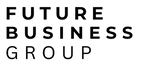


Kommentare