Das Ende des strategischen Fits
- Stefan Tewes

- 2. Okt. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Die Betriebswirtschaftslehre hat in den letzten Jahrzehnten ein Leitbild geprägt, das Generationen von Führungskräften Orientierung gab: die Idee des strategischen Fits. Organisationen sollten ihre internen Fähigkeiten und Ressourcen so aufeinander abstimmen, dass sie bestmöglich mit den Anforderungen ihrer Umwelt zusammenpassten. Der Gedanke ist so einleuchtend wie wirkungsvoll: Wer seine Stärken klar kennt, die Dynamiken des Marktes analysiert und beides konsequent zusammenführt, der sichert sich Wettbewerbsvorteile und überlebt langfristig im Wettbewerb. Porters Wettbewerbsstrategien, Ansoffs Wachstumslogiken oder die SWOT-Analyse haben diese Denkweise institutionalisiert. Auch der Resource-Based View oder das Konzept der Core Competencies haben Unternehmen den Weg gewiesen, ihr Innenleben so zu strukturieren, dass sie im Außen dauerhaft anschlussfähig bleiben.
Doch dieses Denken ist in einer Zeit entstanden, die wir heute fast nostalgisch als stabil bezeichnen könnten. Märkte bewegten sich zwar, aber in absehbaren Bahnen. Technologische Innovationszyklen dauerten Jahre, manchmal Jahrzehnte. Gesellschaftliche Werteveränderungen waren tiefgreifend, aber langsam. Strategische Planung hatte damit eine Grundlage, die heute zunehmend brüchig geworden ist. Die Welt, in der wir uns bewegen, ist durch Gleichzeitigkeit, Beschleunigung und Komplexität geprägt. Technologische Disruptionen entstehen im Jahrestakt, neue Plattformlogiken stellen Geschäftsmodelle in Frage, und gesellschaftliche Debatten verändern innerhalb weniger Monate die Erwartungen von Kunden und Stakeholdern.
Genau an dieser Stelle stößt das klassische BWL-Denken an seine Grenzen. Die Logik des Fits, die in stabilen Kontexten Orientierung bot, wird in hochdynamischen Umwelten zum Risiko. Ein Fit, den ein Unternehmen heute erreicht, kann morgen bereits obsolet sein. Ein strategisches Gleichgewicht, das mühsam erarbeitet wurde, wird durch externe Schocks, regulatorische Veränderungen oder disruptive Wettbewerber über Nacht verschoben.
Wenn wir diese Entwicklung nüchtern betrachten, lassen sich vier zentrale Problembereiche identifizieren, die den Fit-Ansatz schwächen:
Veränderungsgeschwindigkeit: Strategische Pläne verlieren ihre Halbwertszeit. Prognosen, die früher für fünf Jahre galten, sind heute nach 18 Monaten überholt.
Komplexität: Veränderungen lassen sich nicht mehr isoliert betrachten, sondern wirken über Systeme hinweg. Ein Impuls im politischen oder technologischen Bereich verändert binnen kürzester Zeit ganze Wertschöpfungsketten.
Statische Ressourcenlogik: Kompetenzen, die früher selten und schwer imitierbar waren, können durch KI, Plattformmodelle oder globale Skalierung in kürzester Zeit kopiert werden.
Vom Foto zum Video: Tools wie SWOT oder Business Model Canvas beschreiben den Status quo (den Augenblick), aber sie sind nicht in der Lage, den permanenten Prozess der Veränderung abzubilden.
Die Problematik lässt sich durch den Begriff der Sweetspots der Zukunft fassen, die als Gegenentwurf zur statischen Logik des Fits verstanden werden können. Während klassische Ansätze darauf abzielen, einen klar definierbaren Punkt zu identifizieren, an dem innere Strukturen und äußere Anforderungen „passen“, beschreiben Sweetspots dynamische Gleichgewichtszonen. Diese sind nicht festgelegt, sondern entstehen fortlaufend neu. Sie stellen keine statische Position dar, sondern ein flüchtiges, zugleich hoch produktives Zusammenspiel zwischen innerer Handlungsfähigkeit und äußeren Möglichkeitsräumen.
Das lässt sich in einer Gegenüberstellung verdeutlichen:
Klassischer Fit (BWL) | Sweetspot (Future Model) |
Stabilität als Ziel | Dynamik als Bedingung |
Innen und Außen sollen möglichst „passen“ | Innen und Außen treten in produktive Resonanz |
Einmal erarbeitet, möglichst langfristig gültig | Fragiles Gleichgewicht, immer wieder neu herzustellen |
Planung, Kontrolle, Steuerung im Vordergrund | Emergenz, Anpassung, Bewegung im Vordergrund |
Fokus: Wettbewerbsvorteil sichern | Fokus: Zukunftsfähigkeit gestalten |
Die Sweetspots zeigen, dass es nicht mehr um das einmalige Erreichen einer optimalen Position geht, sondern um die Fähigkeit, im Spannungsfeld von Innen- und Außendynamiken immer wieder produktive Anschlussfähigkeit herzustellen. Organisationen müssen begreifen, dass Zukunft nicht länger ein „Ziel“ ist, das planbar erreicht wird, sondern ein Gestaltungsraum, in dem sich Innen und Außen fortlaufend neu aufeinander beziehen.
Ein Blick in die Praxis macht die Fragilität des Fits sichtbar. In der Automobilindustrie etwa galt jahrzehntelang die Formel: effiziente Produktion plus starke Marke gleich Wettbewerbsvorteil. Mit der Digitalisierung und dem Wandel zur Elektromobilität verschob sich das Spielfeld radikal. Unternehmen, die am alten Fit festhielten, optimierten weiter ihre Produktionslogik. Andere besetzten neue Sweetspots – durch die Kombination aus Softwarekompetenz, Nachhaltigkeit und Plattformdenken. Ähnlich im Handel: klassische Ketten optimierten Sortiment und Standort, während Plattformen ganz andere Sweetspots besetzten – Logistik, Daten und Kundenzentrierung. In beiden Fällen zeigte sich: Der Fit von gestern wurde zur Falle von heute.
Der Punkt ist klar: Die klassische BWL hat Unternehmen wertvolle Werkzeuge geliefert, aber ihre Logik ist zu statisch, um die Realität der Gegenwart zu fassen. Der strategische Fit bleibt ein wichtiges Analyseinstrument, aber er genügt nicht, um Zukunftsfähigkeit zu gestalten. Wir brauchen eine neue Perspektive, die Sweetspots nicht als stabile Zielzustände, sondern als dynamische Entwicklungsräume begreift.
Damit wird der Übergang sichtbar: von der klassischen Logik der Kontrolle hin zur Logik der Emergenz. Im Mittelpunkt steht dabei eine zentrale Frage: Wenn der Fit nicht mehr ausreicht – wie können Organisationen lernen, ihre Sweetspots immer wieder neu zu identifizieren? Die Antwort liegt nicht in starren Formen klassischer Planung, sondern in einem veränderten Verständnis von Zukunft als offenem, gestaltbarem Spannungsfeld. Diese Perspektive eröffnet den Rahmen für eine vertiefende Auseinandersetzung, die im nächsten Schritt entfaltet werden kann.
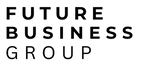

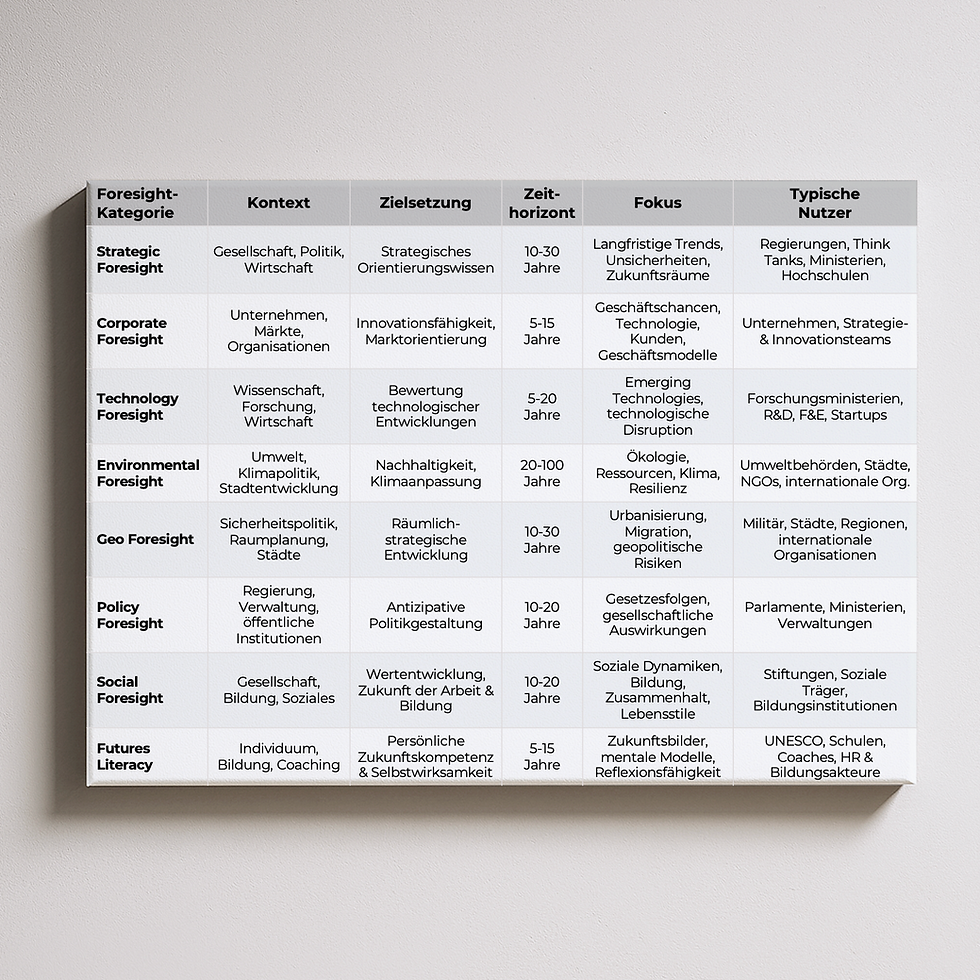

Kommentare