Future Challenges: Warum kontextfreie Zukunftsforschung scheitert
- Stefan Tewes

- 19. Aug. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Von der Trendliste zur Leere
Zukunftsforschung hat sich lange auf das Sammeln und Beschreiben von Trends konzentriert. Was wird wichtiger? Was wird weniger relevant? Welche Themen werden „groß“? Doch das reine Aufzählen von Trends führt kaum weiter. Denn im Kern bleibt unklar: Was bedeutet ein Trend für uns? Wer ist betroffen? Welche Probleme, Konflikte oder Chancen entstehen daraus?
Hinzu kommt: Es gibt gar keine universellen Trends. Was in einer Branche ein Zukunftsthema ist, spielt in einer anderen keine Rolle. Was in Europa als entscheidender Wandel gilt, kann in Asien längst Alltag sein – oder umgekehrt. „Der“ Trend existiert also nicht; er ist immer abhängig vom Kontext, vom Akteur, von der Fragestellung. Deshalb sind generische Trendberichte oft austauschbar und bleiben ohne Handlungsfolge.
Future Challenges: Die neue Zeitrechnung der Foresight
Genau hier setzen Future Challenges an. Sie markieren eine neue Zeitrechnung in der Zukunftsforschung, weil sie den Schritt weg vom bloßen Beschreiben hin zum Verstehen und Gestalten vollziehen. Während Trends abstrakte Schlaglichter auf mögliche Entwicklungen werfen, sind Future Challenges konkrete, kontextgebundene Leitfragen, die sichtbar machen, wo sich in Zukunft Probleme zuspitzen, Chancen eröffnen oder Zielkonflikte entstehen. Eine Future Challenge ist damit mehr als eine Prognose oder eine Beobachtung. Sie beschreibt ein Herausforderungsfeld, das aus dem Zusammenspiel von strukturellen Bedingungen (wie politischen Institutionen, gemeinschaftlichen Werten oder ökonomischen Zwängen) mit absehbaren Veränderungen entsteht. Anders gesagt: Trends zeigen, was sich allgemein bewegt – Future Challenges zeigen, warum das für uns relevant ist und welche Handlungsfolgen es haben kann.
Das Besondere an Future Challenges ist ihre Breite bei gleichzeitiger Tiefe. Sie können ungelöste Probleme benennen, etwa die Frage, wie Energiesicherheit und Klimaschutz gleichzeitig gewährleistet werden können. Sie sind die Basis, um Chancen sichtbar zu machen, beispielsweise die Möglichkeit, durch Künstliche Intelligenz neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und sie können Dilemmata aufzeigen, in denen es keine einfachen Lösungen gibt – etwa zwischen Effizienzsteigerung und Resilienz. Damit bieten Future Challenges einen Handlungsrahmen für Zukunftsforschung. Sie übersetzen abstrakte Themenfelder wie „Digitalisierung“, „demografischer Wandel“ oder „Klimawandel“ in präzise Leitfragen. Diese Fragen sind bewusst offen formuliert, damit sie nicht vorschnell auf eine Lösung hinauslaufen, sondern Diskussion, Reflexion und strategisches Denken anregen. So entstehen keine endlosen Trendlisten, sondern strategische Navigationspunkte, die Orientierung schaffen und Handlungsoptionen eröffnen.
Beispiel 1: Künstliche Intelligenz
Das Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ ist allgegenwärtig. Ein klassischer Trendbericht würde nüchtern feststellen: „KI entwickelt sich rasant und wird stetig wichtiger.“ Doch damit ist nichts gewonnen. Erst als Future Challenge wird die Relevanz sichtbar: Wie können wir den Einsatz von KI so gestalten, dass Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Werte in Balance bleiben? Diese Leitfrage entfaltet ihre Sprengkraft im Kontext. Politisch geht es um Regulierung und geopolitische Positionierung, wirtschaftlich um neue Geschäftsmodelle und Produktivität, legitimatorisch um Datenschutz und Grundrechte, und in der Gemeinschaft um Akzeptanz und Veränderungen im Arbeitsleben. KI ist also nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern ein gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld.
Beispiel 2: Ältere Gesellschaft
Auch die Alterung der Gesellschaft wird oft als Trend beschrieben: „Die Bevölkerung altert.“ Richtig, aber trivial. Erst als Future Challenge wird daraus eine relevante Leitfrage: Wie lässt sich der demografische Wandel bewältigen, ohne soziale Systeme zu überlasten – und gleichzeitig Chancen für Teilhabe und Arbeit im Alter zu eröffnen? Wieder ist der Kontext entscheidend. Politisch steht die Stabilität von Renten- und Gesundheitssystemen auf dem Spiel, wirtschaftlich geht es um Fachkräftemangel und Produktivität. Legitimation betrifft die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen, und die Gemeinschaft ringt mit Fragen von Solidarität, Altersbildern und Integration. Nur als Challenge wird der demografische Wandel handlungsleitend.
Beispiel 3: Klimawandel
Der Klimawandel schließlich gilt oft als Megatrend: „Das Klima verändert sich.“ Doch diese Feststellung ist zu abstrakt, um handlungsfähig zu machen. Erst die Future Challenge stellt die entscheidende Frage: Wie können Gesellschaften mit den Folgen des Klimawandels umgehen und zugleich nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsformen entwickeln? Damit treten die Spannungen klar hervor: Politik muss Ziele setzen, Abkommen verhandeln und Infrastrukturen anpassen. Wirtschaftlich geht es um die Transformation von Energie, Industrie und Mobilität. Legitimation betrifft die Akzeptanz von Kosten, Verboten und Verteilungswirkungen. Und in der Gemeinschaft sind es Alltagserfahrungen – Hitzewellen, Konsummuster, lokale Resilienz –, die Zukunft greifbar machen.
Fazit
Diese Beispiele zeigen: Future Challenges sind nicht eng definierte Aufgaben, sondern offene Leitfragen. Sie markieren die Punkte, an denen sich Zukunft entscheidet – und sie machen sichtbar, welche Spannungsfelder im Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft, Legitimation und Gemeinschaft bearbeitet werden müssen. Damit verschiebt sich der Fokus der Foresight-Arbeit fundamental. Es geht nicht länger darum, möglichst viele Trends oder Themenfelder zu beschreiben. Es geht darum, die relevanten Herausforderungen zu identifizieren: Wo entstehen neue Zielkonflikte? Wo bedrohen Veränderungen bestehende Strukturen? Wo eröffnen sich Chancen, die heute noch nicht genutzt werden?
Future Challenges sind damit kein enger Begriff, sondern ein breites Konzept. Sie können Probleme markieren, Chancen benennen oder Zielkonflikte offenlegen. In jedem Fall zwingen sie dazu, Zukunft im Kontext zu denken – und nicht als lose Ansammlung von Buzzwords. Ohne diesen Perspektivwechsel bleibt Zukunftsforschung oberflächlich. Mit Future Challenges dagegen wird sie zur Navigationshilfe: Sie zeigt nicht nur, dass sich etwas bewegt, sondern erklärt, warum es relevant ist, wen es betrifft und wie man damit umgehen kann.
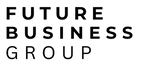


Kommentare