Wer ist wirklich Experte?
- Stefan Tewes

- 14. Juli 2025
- 7 Min. Lesezeit
Vier Kriterien und die Rolle der Datenerhebung in der Zukunftsforschung
In der Deutungshoheit um die Zukunft ist eines klar: „Daten sprechen lauter als Meinungen.“ Nicht jede Person mit lautstarken Zukunftsprognosen ist tatsächlich eine Expertin oder ein Experte. Für fundierte Zukunftsforschung und belastbare strategische Entscheidungen braucht es echte Erkenntnis. Doch woran erkennen wir diese? Woran erkennen wir, ob die Datenerhebung wirklich verlässlich ist?
Im Buch „Megatrend Research“ sind vier klare Auswahlkriterien herausgearbeitet worden, die echte Zukunftsexperten erfüllen müssen. Diese Kriterien sind nicht bloß theoretischer Natur – sie sind methodisch wie unternehmerisch notwendig, um aus der Flut an Trends (Overload) diejenigen Einsichten zu filtern, die wirklich relevant und umsetzbar sind. Im Folgenden werden die vier Kriterien systematisch erläutert. Dabei wird aufgezeigt, warum viele vermeintliche Zukunftsexperten diesen Anforderungen nicht genügen und welche Konsequenzen sich daraus für die Qualität strategischer Entscheidungen ergeben.
1. Verantwortung und Umsetzung von Problemlösungen
Ein Zukunftsexperte zeichnet sich erstens dadurch aus, dass er Verantwortung für die Lösung eines konkreten Problems oder einer Herausforderung übernimmt und maßgeblich an der Umsetzung der Lösung beteiligt ist. Das bedeutet: Die Person hat nicht nur theoretisches Wissen zu Zukunftsthemen, sondern hat dieses Wissen bereits praktisch eingesetzt, um echte Probleme zu bewältigen. Wer z. B. eine digitale zukunftswirksame Transformation in einem Unternehmen verantwortlich geleitet hat oder ein Innovationsprojekt von der Idee bis zur Umsetzung durchführte, demonstriert greifbare Erfahrung. Solche Erfahrungen zeigen, dass der Experte nicht in abstrakten Modellen steckenbleibt, sondern Lösungen realisieren kann – mit allen Widerständen, die dazugehören.
In der Praxis trennt dieses Kriterium die ‚Spreu vom Weizen‘. Viele selbsternannte Zukunftsvisionäre haben nie eigenverantwortlich Veränderungen umgesetzt; sie verkaufen Visionen, ohne je für deren Umsetzung geradegestanden zu haben. Ein echter Zukunftsexperte hingegen steht für Resultate ein. Diese Verantwortungsübernahme sorgt dafür, dass seine Empfehlungen realitätsgeprüft sind. Für Unternehmen ist das unerlässlich: Strategien für die Zukunft müssen nicht nur auf dem Papier glänzen, sondern sich auch praktisch bewähren. Nur wer bereits Probleme gelöst hat, kann einschätzen, was wirklich funktioniert – und was nur schönen Worten gleicht.
2. Exklusiver Zugang zu Informationen
Zweitens braucht der seriöse Zukunftsforschende exklusiven Zugang zu Informationen, die nicht jeder hat – auch nicht die generative KI. Dazu zählen Insiderwissen, aktuelle Forschungsdaten oder spezielle Netzwerke – Informationen also, die über das hinausgehen, was in den Massenmedien und frei zugänglichen Quellen ohnehin für alle sichtbar ist. Dieser exklusive Zugang verschafft dem Experten einen tieferen Einblick in Entwicklungen, anstatt nur an der Oberfläche zu kratzen.
Warum ist das so wichtig? Zukunftsforschung lebt von frühzeitigen Signalen und versteckten Trends. Wer nur allgemein verfügbare Infos nutzt – etwa populäre Blogs oder trendige Schlagzeilen – liefert meist wenig Mehrwert gegenüber dem, was die Unternehmensführung selbst in der Zeitung lesen kann. Wirklich wertvolle Zukunftserkenntnisse entstehen dagegen oft aus Vorwissen und Primärforschung: beispielsweise aus Beteiligung an einem vertraulichen Expertennetzwerk, aus Zugang zu unveröffentlichten Studien oder aus eigener Trend-Datenanalyse. Eine Expertin mit exklusiven Informationen kann Entwicklungen erkennen, bevor sie für alle offensichtlich sind. So jemand kann etwa anhand proprietärer Marktdaten frühzeitig abschätzen, ob ein Technologietrend wirklich Fahrt aufnimmt oder nur ein Hype ist. Für strategische Entscheidungen ist dieser Wissensvorsprung Gold wert – er schützt davor, blind der Masse hinterherzulaufen.
Viele sogenannte Trendgurus können dieses Kriterium jedoch nicht erfüllen. Sie stützen sich oft auf das, was ohnehin schon überall diskutiert wird, und verpacken Bekanntes als angeblich neue Einsicht – mit schönen Worten. Für echte Wettbewerbsvorteile taugen solche Gemeinplätze wenig. Ohne exklusive Datenbasis bleibt die Trendanalyse flach. Unternehmenslenker sollten daher stets fragen: Worauf stützt der Experte seine Prognosen? Sind es eigene Erhebungen, Insiderquellen – oder nur allgemein verfügbare Informationen?
3. Nachweisbare Fähigkeiten und Know-how
Drittens müssen Zukunftsexperten nachweisbare Fähigkeiten und ein belastbares Know-how vorweisen. Das klingt selbstverständlich, ist aber ein harter Prüfstein. Konkret heißt das: Die Qualifikationen und Erfahrungen des Experten sollten klar belegbar und nachvollziehbar sein. Dazu gehören selbstverständlich formale Meriten wie relevante Studienabschlüsse oder wissenschaftliche Publikationen, aber es geht um mehr als akademische Titel. Genauso wichtig sind praktische Fachkenntnisse und Erfolge, welche die Person in ihrem Gebiet ausgewiesen haben.
Ein Beispiel: Eine Expertin für die Zukunft der Mobilität hätte idealerweise einen Hintergrund etwa in Verkehrs- oder Stadtplanung und Erfahrung in Pilotprojekten für neue Mobilitätskonzepte. Vielleicht hat sie an der Einführung eines autonomen Bussystems mitgewirkt oder eine Studie zur Verkehrswende geleitet. Solche Errungenschaften lassen sich verifizieren – sie zeugen von echtem Know-how. Ebenso sollte ein Technologiefuturist belegbare Kenntnisse z.B. in KI oder Robotik haben, untermauert durch Projekte oder Patente.
Diese Nachweisbarkeit schafft Vertrauen: Sie zeigt, dass der oder die Betreffende fundierte Urteile im Fachgebiet fällen kann, statt nur im Konjunktiv oder in Narrativen zu sprechen. In einer Zeit, in der fast jeder sich online als „Experte“ ausgibt, gewinnen Fakten (im Lebenslauf) an Bedeutung. Unternehmen sollten daher bei der Auswahl ihrer Zukunftsberater genau hinschauen: Welche nachprüfbaren Kompetenzen bringt die Person mit? Gibt es Referenzen, Erfolge, Publikationen? Wenn diese Transparenz fehlt, ist Skepsis angebracht.
4. Führung und Anleitung von Menschen
Viertens schließlich kommt ein Kriterium hinzu, das über das Fachliche hinausgeht: Führung und Anleitung von Menschen. Ein anerkannter Zukunftsexperte sollte nicht nur Fachautorität sein, sondern auch andere Menschen führen und/oder inspirieren können. Zukunftsgestaltung ist immer Teamarbeit – ob in Unternehmen, Institutionen oder der Gesellschaft. Daher gilt: Hat die Person bereits Teams, Projekte oder Organisationen in Richtung Zukunft geführt? Dies kann sich etwa in einer Führungsposition zeigen, in der sie Veränderungen vorantreibt, oder in der Leitung eines Innovationslabors, Instituts oder einer strategischen Task-Force. Auch die Rolle als Mentor, Dozent oder Berater, in der man andere anleitet, fällt hierunter.
Wieso ist Führungsfähigkeit ein Auswahlkriterium? Weil Trend- und Zukunftswissen erst dann wirklich wertschöpfend wird, wenn es Menschen motivieren und mobilisieren kann. Ein Experte mag brillante Ideen haben – doch wenn er diese nicht vermitteln kann oder keine Erfahrung darin hat, Menschen zu begeistern, bleiben seine Ideen wirkungslos. Wer hingegen schon bewiesen hat, dass er Mitarbeiter, Stakeholder oder Öffentlichkeit für Zukunftsthemen gewinnen kann, der erhöht die Chance, dass prognostizierte Veränderungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Leadership im Zukunftskontext heißt, Visionen in die Organisation hineintragen und Wandel aktiv steuern zu können.
Viele selbsternannte Zukunftspropheten scheitern genau hier: Sie bleiben Einzelkämpfer, ohne echte Gefolgschaft oder organisatorische Verankerung. Vielleicht glänzen sie auf der Konferenzbühne, doch intern in Unternehmen stoßen ihre Konzepte auf Widerstand, weil ihnen das Fingerspitzengefühl für Transformation fehlt. Eine belastbare Zukunftsexpertin bringt dagegen Erfahrung und Glaubwürdigkeit mit – sie kann als Guide für den Wandel auftreten. Für Entscheidungsträger ist dieses Kriterium wichtig, denn die beste Strategie nützt nichts, wenn man die Mannschaft nicht mit auf die Reise nimmt.
Vermeintliche Zukunftsexperten: Gefahren durch fehlende Tiefe
Warum genügen nun viele sogenannte „Zukunftsexperten“ diesen hohen Maßstäben nicht – und was bedeutet das für strategische Entscheidungen? Die traurige Wahrheit ist: Das Feld der Zukunft zieht auch zahlreiche Oberflächlichkeit an. Wo Zukunft draufsteht, ist nicht immer Substanz drin. Einige Trendgurus und Zukunfts-Vortragskünstler glänzen mehr durch Marketing als durch Merit. Sie haben vielleicht ein Talent, Trends bunt auszumalen oder Ängste zu schüren, ohne jedoch die oben genannten Kriterien zu erfüllen. Oft fehlt die praktische Umsetzungserfahrung (Kriterium 1), der Zugang zu exklusivem Wissen (Kriterium 2) oder eine fundierte Kompetenz (Kriterium 3) – oder alles zusammen. Manche sind auch Einzelgänger ohne Führungsbackground (Kriterium 4). Es gibt also viele, die maximal ein oder zwei der Kriterien abdecken, aber kaum jemals drei oder vier.
Die Konsequenzen solcher Defizite zeigen sich direkt in der Qualität der Prognosen und Empfehlungen. Ohne diese Tiefe bei der Expertenauswahl bleiben die Erkenntnisse nämlich auf sehr oberflächlichem Niveau. Es werden dann oft keine wirklich neuen Trends identifiziert, sondern lediglich generische Aussagen abgeleitet. Mit anderen Worten: Statt präziser Zukunftsbilder erhält man Binsenweisheiten. Solche „Experten“ neigen dazu, jede Frage mit den immergleichen Buzzwords zu beantworten. Seien wir ehrlich: Schlagworte wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung werden dann pauschal als Allheilmittel auf alles gepappt – als wären sie für jedes Unternehmen zu jedem Zeitpunkt die richtige Antwort. Doch das stimmt eben nicht. Jede Branche, jede Organisation hat spezifische Herausforderungen; wer hier nur Modewörter liefert, hilft den Entscheidern kein Stück weiter. Im Gegenteil, er wiegt sie womöglich in falscher Sicherheit oder lenkt Ressourcen in die falschen Initiativen.
Strategische Entscheidungen, die auf solch wackliger Grundlage getroffen werden, sind entsprechend anfällig. Unternehmen laufen Gefahr, wichtige Weichen falsch zu stellen, wenn sie auf die falschen Ratgeber hören. Beispielsweise könnte ein Vorstand, geblendet von einem schillernden „Zukunftsberater“, in ein Trendthema investieren, das gar nicht zum Geschäftsmodell passt – während echte Zukunftschancen übersehen werden. Oder es werden Maßnahmen ergriffen, die gut klingen, aber operativ nicht durchdacht sind, weil der Berater die Umsetzungserfahrung fehlt. Dass der Schuss nach hinten losgeht, wird dann vielleicht erst Jahre später offensichtlich. Dann sind wertvolle Zeit und Ressourcen vergeudet.
Kurzum: Wer bei der Wahl der Zukunftsexperten nicht streng genug ist, riskiert oberflächliche Analysen, blinde Flecken und meinungsgetriebene Fehleinschätzungen. Tatsächlich weisen so manche Strategie-Dossiers erhebliche Lücken auf oder sind mehr Meinung als fundierte Analyse. Das kann sich kein Entscheider leisten. Foresight ohne Substanz ist wie ein Kompass, der nach Lust und Laune die Richtung ändert.
Fazit: Qualität als Voraussetzung für Zukunftserfolg
Die dargestellten vier Kriterien – Verantwortung in der Problemlösung, exklusiver Informationszugang, nachweisbares Know-how und Führungsstärke – sind mehr als methodische Feinheiten. Sie sind aus guter Gründe unternehmerisch notwendig, um im modernen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. In einer Welt voller Unsicherheit und Hype sind sie die Qualitätsfilter, die echte Zukunftskompetenz von bloßem Zukunftsgerede trennen. Nur wenn wir diese Maßstäbe anlegen, erhalten wir belastbare, evidenzbasierte Zukunftsinsights, die als solide Entscheidungsgrundlage dienen können. Entscheidungen über die Zukunft dürfen nicht auf Meinungsmache basieren, sondern müssen sich auf harte Fakten und fundierte Analysen stützen – genau das gewährleisten streng ausgewählte Experten.
Für die unternehmerische Praxis bedeutet das: Führungskräfte sollten bewusst auf die Qualität ihrer Zukunftsberater achten. Es reicht nicht, dem erstbesten Trendbuch-Bestsellerautor oder Social-Media-Propheten zuzuhören. Stattdessen sollte man fragen: Hat diese Person in meinem Thema schon Verantwortung getragen und etwas bewirkt? Hat sie Einblicke, die mein Team nicht hat? Kann sie belegen, was sie behauptet? Und hat sie die Fähigkeit, meine Organisation durch den Wandel zu führen? Nur wenn diese Fragen größtenteils mit Ja beantwortet werden, liegt echte Expertise vor – die Sorte Expertise, die strategische Entscheidungen wirklich nach vorn bringt.
Die hier vorgestellten Kriterien mögen die Messlatte hoch legen – bewusst. Ja, es macht die Suche nach geeigneten Experten anspruchsvoll und hochkarätige Fachleute sind terminlich oft schwer zu greifen. Doch der Aufwand lohnt sich. Ohne diese Tiefe bliebe Zukunftsforschung im Beliebigen stecken und wir erhielten nur triviale Trendsprüche statt tragfähiger Orientierung. Mit hoher Qualität in der Expertenauswahl hingegen wird Zukunftsforschung zu einem belastbaren Kompass. So können Entscheidungsträger darauf vertrauen, dass ihre Strategien nicht auf Sand, sondern auf fundamentiertem Wissen gebaut sind – ein unschätzbarer Vorteil im Wettlauf um die Zukunft.
Kriterium | Leitfragen zur Prüfung |
1. Verantwortung & Umsetzung | Hat die Person eigenverantwortlich Probleme im Zukunftskontext gelöst? War sie an der Umsetzung strategischer Veränderungen direkt beteiligt? |
2. Exklusiver Zugang zu Informationen | Nutzt die Person Primärdaten, proprietäre Quellen oder vertrauliches Branchenwissen? Hat sie Zugang zu Netzwerken mit Insiderperspektive? |
3. Nachweisbares Know-how | Sind relevante Qualifikationen, Publikationen, Projekte oder Auszeichnungen dokumentiert? Ist die Expertise im jeweiligen Fachbereich belegbar? |
4. Führung & Anleitung | Hat die Person Teams, Organisationen oder Transformationsprozesse geleitet? Kann sie Menschen für Zukunftsthemen begeistern und mobilisieren? |
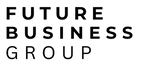

Kommentare